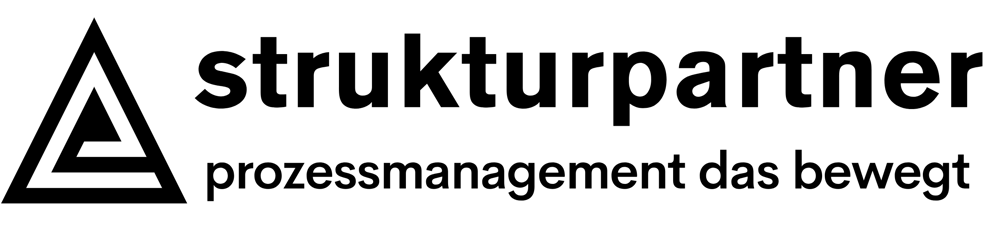„Durch Verknüpfungen entsteht Kontext. Durch Kontext entsteht Wissen über Zusammenhänge. Dadurch verbessern sich Entscheidungen und die Zusammenarbeit wird deutlich besser, was bei der Transformation entscheidend hilft.“
Liebe CIOs und CDOs, wir müssen reden …
Ihr gebt jeden Tag euer Bestes💪, ihr wollt die Organisation schneller machen 💪. Ihr investiert in Technologie, digitale Plattformen und Transformation. Ihr digitalisiert Prozesse und orchestriert Change-Initiativen. Aber: Wenn die Zusammenarbeit auf organisatorischer Ebene nicht funktioniert, laufen selbst die besten Systeme ins Leere.
Statt euch in Meetings zu verlieren, lohnt sich der Blick auf die Realität eurer Organisation: Wer arbeitet wie, mit wem, an was – und warum eigentlich?
Dieser Artikel zeigt, warum das eigentliche Betriebssystem der Zusammenarbeit nicht in der Technik, sondern in den Verhältnissen liegt, in denen Menschen arbeiten. Und wie durch Kontext und Struktur echte Bewegung in die Transformation kommt.
Warum wir über Kontext sprechen müssen.
Viele Organisationen investieren Zeit in Prozesse, Geld in Systeme und Hoffnung in neue Methoden. Und trotzdem bleibt die Wirkung oft aus. Warum? Weil das Verbindende fehlt: Kontext. Erst wenn klar ist, wie Elemente zusammenhängen, entsteht Orientierung, Zusammenarbeit und echte Veränderungskraft. Dieser Artikel zeigt, warum Kontext kein Nebenschauplatz ist, sondern der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit.
Die „Schere“ zwischen Organisation und Markt.
Organisationen werden komplexer, langsamer und schwerfälliger. Märkte dagegen dynamischer und unberechenbarer. Diese Schere öffnet sich weiter – und wer sie ignoriert, riskiert, schmerzhaft erwischt zu werden. Während Unternehmen in immer mehr Details versinken, ändern Kundenanforderungen und Marktentwicklungen rasend schnell die Spielregeln. Nur wer sich flexibel und schnell an neue Bedingungen anpassen kann, wird langfristig erfolgreich bleiben.

Disruption im E-Commerce: Wenn eine Branche in Rekordzeit durchgerüttelt wird.
Ein Blick auf den Fashion-E-Commerce zeigt, wie schnell jahrhundertealte Strukturen ins Wanken geraten:
- Onlineshops verdrängen stationäre Händler: Traditionelle Strukturen geraten unter Druck, Filialschließungen häufen sich.
- Marktplätze ersetzen Onlineshops: Plattformmodelle revolutionieren den Vertrieb, und Händler verlieren die direkte Beziehung zu Kunden.
- Social Media dominiert Marktplätze: Instagram und TikTok bestimmen Kaufimpulse, Marken müssen lernen, digital zu denken und zu handeln.
- Entertainment schlägt Social Media: Kunden wollen unterhalten werden, nicht nur shoppen. Marken werden zu Entertainern, Produkte treten in den Hintergrund.
- KI übernimmt das Ruder: Hyperpersonalisierung revolutioniert erneut den E-Commerce und verändert Kundenerwartungen fundamental.
Ich bin mir sicher, dass nahezu jede Branche früher oder später vor ähnlichen Herausforderung wie die Fashion-Branche stehen wird.
Jede dieser Verschiebungen zerschneidet ganze Organisationslogiken. Wer hier auf starre, isolierte Strukturen setzt, wird bald aus dem Spiel sein.

Warum das gute alte Taylor-Modell ausgedient hat.
Früher funktionierte Frederick Taylors Modell der Arbeitsteilung wunderbar: klare Aufgaben, klare Grenzen. Heute verlangen Komplexität und Dynamik Flexibilität, Vernetzung und Kontext. Mitarbeitende müssen nicht nur ihre Aufgaben kennen, sondern verstehen, wie ihre Arbeit in das große Ganze passt. Nur so entstehen Agilität, Innovation und echte Wettbewerbsfähigkeit.
Operative Inseln – wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.
In vielen Unternehmen existieren sogenannte operative Inseln. Funktions- und Hierarchiebarrieren behindern die Zusammenarbeit, sorgen für Informationslücken und fördern Ineffizienzen. Kurzfristig scheint das effizient – langfristig sorgt es für Stillstand und Innovationsverlust. Wenn jeder Bereich nur seinen eigenen Erfolg im Blick hat, verlieren alle den Anschluss an Markttrends und übergreifende Unternehmensziele.

Der unsichtbare Stolperstein: Wenn Kontext fehlt.
Organisationen haben oft alles: Meetings, Prozesse, Systeme. Doch häufig fehlt eines – Klarheit darüber, wie alles zusammenhängt. Das Ergebnis sind Missverständnisse, Reibungsverluste und Doppelarbeit. Mitarbeitende wissen nicht, wie ihre Arbeit zu Zielen beiträgt, Führungskräfte entscheiden ohne klare Informationsgrundlage.
„Wir haben Prozesse, aber keiner weiß, warum.“
Was unser Gehirn intuitiv versteht, bleibt Unternehmen oft verborgen.
Unser Gehirn braucht Kontext, um Sinn aus Informationen zu machen. Einzelne Datenpunkte sind nur Rauschen – erst Kontext schafft Erkenntnis. Ohne Kontext bleiben Informationen isoliert und bedeutungslos. Unternehmen, die Zusammenhänge sichtbar machen, helfen Mitarbeitenden, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen.
„Um Wissen produktiv zu machen, müssen wir lernen, sowohl den Wald als auch den einzelnen Baum zu sehen. Wir müssen lernen, Zusammenhänge herzustellen.“ – Peter Drucker
Entscheidungen ohne Kontext – eine riskante Lotterie.
Was für unser Denken gilt, gilt auch für Entscheidungen. Viele davon basieren auf isolierten Datenpunkten oder Bauchgefühl. Erst wenn Datenpunkte zu Informationen, diese zu Wissen und schließlich zu echten Einsichten werden, entsteht eine solide Entscheidungsgrundlage. Kontext verleiht Entscheidungen die nötige Tiefe und Klarheit. Führungskräfte raten nicht mehr – sie handeln strategisch.
Wer Kontext schafft, trifft Entscheidungen auf Basis tatsächlicher Gegebenheiten.
Prozessmanagement mit Verknüpfungen wird erst richtig wirksam.
Viele Organisationen betreiben Prozessmanagement – aber oft nur auf der Ebene von Abläufen. Da werden Aktivitäten beschrieben, in hübschen Diagrammen visualisiert und vielleicht noch Kennzahlen ergänzt. Doch was dabei fehlt, ist das Entscheidende: der Kontext. Abläufe allein fördern häufig sogar das Silodenken. Denn sie zeigen nur, was innerhalb eines Prozesses passiert – nicht, wie dieser Prozess in der Organisation eingebettet ist.
Erst wenn Prozesse mit Rollen, IT-Systemen, Governance-Vorgaben, Normen, Risiken oder relevanten Dokumenten verknüpft werden, entsteht ein echter Mehrwert. Diese Verknüpfungen schaffen Kontext – und damit Verständnis. Mitarbeitende erkennen, wie ihre Aufgaben mit anderen Bereichen zusammenhängen. Führungskräfte sehen Wechselwirkungen und können gezielter steuern. Aus einem isolierten Ablauf wird ein tragfähiges Netz. Und erst dieses Netz ermöglicht Zusammenarbeit, die ihren Namen verdient.

Digitale Zwillinge schaffen Verbindungen.
Kontext entsteht nicht zufällig – er wird geschaffen. Ein digitaler Zwilling der Organisation macht sichtbar, wie alles miteinander verbunden ist. Das sorgt für Klarheit, verbessert Entscheidungen und reduziert Abstimmungen dramatisch. Mitarbeitende und Führungskräfte gewinnen Überblick darüber, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben, und können schneller und effektiver handeln.
Von Koordination zur echten Kooperation.
Organisationen sind oft Meister in der Koordination. Doch echte Wirkung entsteht durch Kooperation. Koordination erzeugt oft nur oberflächliche Klarheit. Kooperation entsteht erst durch gemeinsames Verständnis und gemeinsame Ziele. Reinhard K. Sprenger, einer der profiliertesten Führungsexperten Deutschlands, spricht in diesem Zusammenhang davon, dass moderne Unternehmen eine Kooperationsarena sind. Ein starkes Bild.
Koordination heißt: „Wer spricht wann mit wem?“ Kooperation bedeutet: „Alle verstehen das Gleiche – ohne es ständig neu besprechen zu müssen.“

Verhältnisse schaffen Verhalten.
Verhalten entsteht nicht im luftleeren Raum – es ist ein Produkt der Verhältnisse, in denen Menschen arbeiten. Oder wie Oliver Sowa es treffend formuliert: „Verhältnisse schaffen Verhalten.“ Statt permanent am Mindset der Mitarbeitenden herumzuschrauben, ist es oft viel wirksamer, sich die tatsächlichen Rahmenbedingungen anzusehen, unter denen sie arbeiten.
Wenn diese Verhältnisse unsichtbar, widersprüchlich oder lückenhaft sind, kämpfen Mitarbeitende täglich mit Reibungsverlusten, Frust und Orientierungslosigkeit. Energie verpufft im System – nicht am eigentlichen Ziel.
Nur wenn die Rahmenbedingungen sichtbar gemacht werden – also wer mit wem, woran, mit welchem System, nach welcher Regel und mit welchem Ziel arbeitet – lässt sich gezielt und systematisch an diesen Verhältnissen arbeiten. Genau dann entsteht die Chance, Strukturen so zu gestalten, dass das gewünschte Verhalten nicht nur möglich, sondern naheliegend wird. Verhalten wird nicht erzwungen – es ergibt sich.
Wer die Verhältnisse verändert, verändert das Verhalten. Wer sie ignoriert, verschleißt Engagement – jeden Tag, schleichend und teuer.
Change ohne Kontext ist wie Autofahren im Nebel.
Wer Veränderungen ohne Kontext durchführt, riskiert Orientierungslosigkeit. Entscheidungen werden vertagt, Initiativen versanden, Führungskräfte geraten ins Raten. Mitarbeitende fühlen sich unsicher – und die Akzeptanz für Veränderungen sinkt.
Ein klares Lagebild der Organisation schafft Klarheit und Handlungsfähigkeit.
Was bleibt, wenn der Nebel sich lichtet?
Organisationen brauchen nicht mehr Meetings oder Tools, sondern bessere Verknüpfungen. Kontext schafft Klarheit. Klarheit ermöglicht bessere Entscheidungen. Und das sorgt für erfolgreiche Transformationen. Wer Prozesse, Systeme, Rollen und Regeln verknüpft, gewinnt mehr als nur Überblick. Er gewinnt Steuerbarkeit, Geschwindigkeit – und Wirksamkeit.
Wer das heute nicht erkennt, handelt wie die Deutsche Bahn: mit kaputter Infrastruktur durchs Land – und hofft, dass der Fahrplan trotzdem irgendwie aufgeht. Viel Glück dabei.